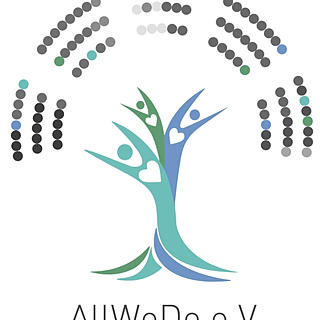Deine Ideen für die Zukunft der Demokratie!
- Daniel Schwarz-Loy
- 23. Sept. 2025
- 15 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 12. Dez. 2025

Wir suchen Deine Ideen für die Demokratie der Zukunft und die Wahlkämpfe 2026 in unserer Region!
Dazu starten wir diesen Aufruf zu einer kreativen Ideenreihe „Demokratie 2050“!
Du kannst uns ab sofort Deine Ideen einreichen und bist herzlich eingeladen, diesen Aufruf in Deinen Kanälen und Netzwerken zu teilen.
Hintergrund: Unsere Demokratie braucht neue starke Visionen! Wir wollen den anti-demokratischen Angriffen neue Energie entgegensetzen können. Dafür braucht es neue Ideen, die mutig über den Status-Quo hinausdenken. Ideen, die konkretisieren, wie die Demokratie in 20 oder 30 Jahren noch viel stärker, lebendiger und überzeugender sein könnte. Daher starten wir gerade das Projekt „Modellstadt Freiburg – Demokratie 2050“. Dazu wollen wir alle Demokratinnen und Demokraten unserer Region und ganz besonders auch Kinder und Jugendlichen in Freiburg zu einer kreativen Ideenreihe aufrufen! Diese frischen Ideen sollen Demokrat:innen neuen Mut und Zuversicht geben. Außerdem sollen diese Ideen die anstehenden Wahlkämpfe in Baden-Württemberg und Freiburg inspirieren. Wir werden diese Ideen regelmäßig in unseren Kanälen teilen. Zudem planen wir Ende 2025/Anfang 2026 einen Workshop zu Demokratie-Ideen mit allen Kandidierenden des OB-Wahlkampfs, in dem diese Ideen eingebracht und mit den Kandidierenden und ihren Wahlkampfteams weiter konkretisiert werden sollen.
Wir freuen uns auf Deine Ideen!
Deinen kurzen Text (am besten 3-4 Absätze pro konkreter Idee) oder Deinen Beitrag kannst Du bei Daniel Hiekel daniel.hiekel@allwedo.eu jederzeit einreichen.
Unsere Ideen für die Zukunft der Demokratie
Stellen wir uns vor, die Demokratie wäre in 20 Jahren noch viel stärker, lebendiger und überzeugender als heute.
Ich stelle mir vor, dass Politiker im Parlament und in den Medien nicht mehr Reden halten wie im alten Griechenland und Rom, in denen sie sich gegenseitig beschimpfen, sich glorifizieren und die Positionen der anderen verächtlich machen.
Ich stelle mir vor, dass das Wissen über gute Kommunikation und Verständigung und gute kollektive Entscheidungen, dass in Organisationen und Unternehmen dafür heute schon umfangreich genutzt wird, auch in die Politik Einzug gehalten hat. Ich stelle mir vor, dass Koalitions-, Fraktions- und Parlamentssitzungen gut moderiert werden- von Moderierenden, deren Interesse und Auftrag es ist, dass unterschiedliche Perspektiven und Anliegen gehört werden, dass gegenseitiges Verständnis entsteht und am Ende eine Entscheidung getroffen wird, die für alle Anliegen möglichst gut ist. Ich stelle mir vor, dass Politiker darüber sprechen, was sie von der anderen Seite verstanden oder sogar gelernt haben. Ich stelle mir vor, dass das sogar für die Opposition gilt, dass auch die Opposition nicht nur Regierungshandeln kritisiert und verächtlich macht, sondern gute Seiten hervorhebt und was sie nachvollziehen kann. Vielleicht gibt es dann aber auch gar keine Opposition, die aus Entscheidungen rausgehalten wird und daher alles nur kritisieren, verächtlich mChen und katastrophisieren muss.
Ich stelle mir vor, dass die gute Kommunikation sogar in den Medien zu sehen ist, dass in Talkshows ebenfalls nicht Fernsehmoderierende sitzen, wie wir sie heute kennen, sondern Moderierende, die genau das tun: Politikern helfen, ihre Perspektiven und Ideen einzubringen, diese gegenseitig zu verstehen und Lösungen zu finden, die möglichst vielen Anliegen gerecht werden. Das wären dann Sendungen, die nicht polarisieren, nicht skandalisieren, sondern Verständnis schaffen und Kreativität fördern, für neue integrative und innovative Lösungen .
Ich stelle mir vor, dass sich dadurch die Zusammenarbeit zwischen demokratischen Politikern deutlich verbessert und vereinfacht, dass dadurch demokratische Parteien wieder koalitionsfähig miteinander werden, dass in der Bevölkerung wieder mehr Respekt und Wertschätzung für Politiker entsteht, weil es mehr gute Nachrichten und weniger Skandale gibt und mehr darüber gesprochen und berichtet wird, was nachvollziehbar ist und was verschiedene Positionen integriert und verbindet. Ich stelle mir vor, dass dadurch mehr Verständnis dafür entsteht, dass es für größere Herausforderungen keine einfachen Lösungen gibt, die nur Vorteile für Alle haben, sondern dass wir als Gesellschaft auch schwierige oder sogar harte Entscheidungen treffen müssen. Ich stelle mir vor, dass wenn man sehen kann, wie schwer es für Politiker ist, solche Entscheidungen gut zu treffen, dass dann auch mehr Empathie, Verständnis und Unterstützung in der Gesellschaft für schwierige Entscheidungen entsteht. Das könnte unserer Demokratie Entscheidungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit zurückgeben und echte gesellschaftliche Innovationskraft stärken.
von Peter Behrendt
Ich stelle mir vor, dass soziale Medien, die Demokratie stärken und ein zentraler Ort für demokratischen Dialog und Austausch sind.
Ich stelle mir vor, dass die Algorithmen der sozialen Medien guten demokratischen Dialog und Austausch fördern, weil sie nicht von wenigen einzelnen weltweiten Firmenchefs entschieden und gestaltet werden, sondern von neuen demokratischen Gremien, die dafür geschaffen wurden. Sie fördern die Verbreitung von positiven und integrativen Nachrichten und Beiträgen, reduzieren die Reichweite von destruktiven, polarisierenden, respektlosen Beiträgen. Zudem fördern sie Verbindungen und Informationsaustausch zwischen verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven oder dem, was man heute Informationsblasen nennt.
In Europa und Deutschland dürfen nur noch soziale Medien betrieben werden, deren Algorithmen von solchen Gremien entschieden und gestaltet werden. In Deutschland gibt es ein halbes Dutzend davon, die in gutem Wettbewerb miteinander stehen und dafür so gestaltet sind, dass man einfach per Knopfdruck von einem zum anderen wechseln kann, wenn einem ein anderes besser gefällt. Damit Wechsel einfach möglich ist und Monopolbildung vermieden wird, sind Profile und Informationen auch aus anderen Netzwerken jeweils zugänglich. Das ermöglichen transparente Open Source Schnittstellen zwischen allen Netzwerken und Medien.
Unabhängige wissenschaftliche Forschungsgruppen evaluieren die Qualität, sowie die persönlichen und gesellschaftlichen Wirkungen der Medien (wie den Einfluss auf psychische Gesundheit, soziale Einbindung, gesellschaftliche Polarisierung, demokratische Überzeugung o.ä.). Sie veröffentlichen die Ergebnisse, die gut sichtbar jederzeit in allen Medien zugänglich sind, damit Nutzer sich fundiert entscheiden können. Der dadurch entstehende Wettbewerb fördert die gesellschaftlich positive Entwicklung der Medien.
Die neuen demokratischen Gremien gestalten die Innovation des jeweiligen Mediums. Sie sind besetzt aus gewählten Politikern, zufällig gelosten und damit ganz unabhängigen Bürger.innen und Expert.innen aus Forschung und Praxis. Sie sind fair bezahlt, werden zu Beginn gut geschult und haben Zugang zu allen Informationen und Entscheider.innen des Mediums. Zentrale Entscheidungen müssen von Ihnen getroffen oder freigegeben werden. Sie können auch die obersten führenden Positionen jährlich entlasten oder abberufen und entscheiden über Bezahlungsgrundsätze, damit sichergestellt ist, dass sie nicht zahnlos sind, sondern zentralen Einfluss im Sinne eines demokratischen Aufsichtsrates haben. Damit Entscheidungen schnell und praxisnah fallen können, sind sie mit ausreichend Zeitkapazitäten ausgestattet.
von Peter Behrendt
Ich stelle mir vor, dass in Schulen demokratischer Dialog umfassend geübt und praktiziert wird, um demokratische Kompetenzen früh zu vermitteln und demokratische Einstellungen und Haltung zu stärken. Demokratischer Dialog heißt konstruktiv, breit m vielen Perspektiven, entscheidend und fundiert.
Dafür werden Schülervertretungen mit mehr Rechten in der Klassen- und Schul(mit)gestaltung zB über Schulkonferenzen ausgestattet, so dass demokratische Gestaltung erlebt und geübt werden können. Zudem erhalten die Klassen- und Schulvertretungen Schulungsangebote für Moderation, gemeinsame Entscheidung, sowie kollektives Projektmanagement. Alle Schüler.innen erhalten in Klassenlehrerstunden Schulungen in Kommunikation, insbesondere aktivem Zuhören, gewaltfreier Kommunikation und Feedback. Dabei wird die Bedeutung von aktiver Mitgestaltung für das gemeinsame Wohl (und nicht nur die Eigeninteressen) genauso vermittelt, wie die Bedeutung davon, kollektive Entscheidungen aktiv mitzutragen, auch wenn man selbst anders entschieden hätte. Zentrale Prinzipien kollektiver Gestaltung und Organisation wie Rollenkonzepte und das Beratungsprinzip werden vermittelt und ausprobierend umgesetzt.
Da heute große Teile der gesellschaftlichen Kommunikation online stattfinden, gibt es extra soziale Netzwerke und Chatgruppen an den Schulen, in denen demokratische und gute Kommunikation gefördert und geschult werden. Sie werden von eigens gewählten und ausgebildeten Online Moderierenden der Schüler.innen eng moderiert und administriert. Zudem gelten klare Regeln für konstruktive, fundierte und zielorientierte Kommunikation. U.a. gibt es klare Zeitregeln, die verhindern, dass die Kinder zu viel Zeit darin verbringen. Diese Regeln können von Administrator.innen zB über befristete Timeouts sichergestellt werden. Alle Algorithmen sind von demokratischen Gremien entschieden und oder freigegeben (siehe anderer Beitrag).
Die Kommunikations-Regeln werden in den Klassenstunden regelmäßig reflektiert, ihre Wirkung ausgewertet und weiterentwickelt.
von Peter Behrendt
Ziele statt Gesetze
Ich stelle mir vor, dass die wichtigsten politischen Entscheidungen gemeinschaftliche verbindliche Zielsetzungen, Prioritätensezungen und Strategien sind, die wir kollektiv erreichen und umsetzen wollen - und nicht mehr Gesetze, die das erlaubte und geförderte Verhalten 1zu1 detailliert und unveränderbar festschreiben, egal wie schnell und radikal sich die Rahmenbedingungen ändern.
Ich stelle mir vor, dass diese Ziele, Prioritäten und Strategien verbindlich das Handeln der staatlichen Organisationen und Verwaltungen leiten und prägen und dass dadurch gerade die Verwaltungen modernisiert, flexibilisiert werden, kunden- und zielorientierter werden und gerade dadurch handlungsfähiger und wirksamer werden.
Ich stelle mir vor, dass diese Ziele für die Gemeinde, Stadt, das Bundesland oder Land als Ganzes und für die einzelnen Themen bzw Ressorts/Ministerien entwickelt und entschieden werden. Ich stelle mir vor, dass diese jeweils Jahresziele erhalten, die bei Bedarf quartalsweise konkretisiert und bei starken Veränderungen auch aktualisiert werden (ähnlich wie bei agilen Zielsetzungen, die zur effektiven Steuerung großer Organisationen genutzt werden). Die Ziele schreiben nicht nur inhaltliche Ziele fest, sondern auch zentrale politische Kennzahlen und Steuerungsgrößen, die zur gemeinsamen, transparenten Erfolgskontrolle genutzt und allen Bürger.innen zugänglich gemacht und erklärt werden. Diese Ziele etablieren neben Wirtschaftswachstum und Haushaltsüberschuss auch wichtige andere gesellschaftliche Zielgrößen, die ähnlich wie in einer Balanced Score Card übersichtlich und schnell einen Einblick in die ganzheitliche gesunde, fruchtbare, gesellschaftliche Entwicklung geben.
Ich stelle mir vor, dass diese Ziele in einem spannenden, partizipativen, demokratischen, umfassenden Prozess festgelegt werden, der vom Parlament initiiert und gesteuert wird, von der politischen Verwaltung organisiert und unabhängig begleitet wird. In diesem Prozess werden neben gewählten Politikern und Expert.innen aus der Verwaltung alle wichtigen Stakeholder und geloste Bürger.innen einbezogen. Die finalen Zielsetzungen und Prioritäten und Strategien werden von den gelosten Bürger.innen und gewählten Politiker.innen entschieden. Beide Gruppen müssen diesen ausreichend zustimmen.
Ich stelle mir vor, dass Ziele wie Lebensqualität, faire Verteilung, CO2 Ausstoß, psychische Gesundheit oder sozialer Zusammenhalt mindestens genauso bedeutsam für die Gesellschaft sind und durch diesen neuen demokratischen Prozess deutlich mehr Aufmerksamkeit und Fokus erhalten. Ggf werden dafür neue Bürgerbefragungen eingeführt, um den Zustand und die Entwicklung regelmäßig zu prüfen und damit steuern zu können.
Es versteht sich eigentlich von selbst, dass für die Umsetzung der Ziele nicht die Politik und Verwaltung alleine zuständig sein kann, sondern alle gesellschaftlichen Akteure, Organisationen und Bürger.innen einen wichtigen Beitrag leisten können, sollen und um erfolgreich zu sein auch müssen. Hierbei spielen zivilgesellschaftliche, religiöse, mediale, wirtschaftliche und Bildungs-Organisationen eine wesentliche Rolle und werden daher in Entwicklung und Umsetzung der Ziele mit einbezogen. Bei diesem Verständnis von Demokratie erhält die staatliche Verwaltung eine ganz neue Rolle: im Sinne der Prozessgestaltung, Koordination, Orchestrierung und sogar Führung und Umsetzungskontrolle demokratischer Entscheidungen durch einzelne Organisationen. Dafür muss sie mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet sein.
von Peter Behrendt
Ein Runder Tisch für Freiburg
von Dr. Elke Fein, Tanja Martin und Toni Charlotte Bünemann
Stellen wir uns vor, die Demokratie wäre in 20 Jahren stärker, lebendiger und überzeugender als heute. Ein wesentlicher Baustein einer lebendigeren, tieferen Demokratie kann ein regelmäßiger Runder Tisch sein.
Wir stellen uns vor, dass an jedem Ort und in jeder Stadt, so auch in Freiburg, zu Runden Tischen eingeladen wird, an denen alle interessierten Bürger*innen regelmäßig zu offenen Gesprächen über die Belange der Stadt zusammenkommen.
Wir verstehen den Runden Tisch als ein moderiertes Gesprächsformat auf der Basis des Bohmschen Dialogs und der Gewaltfreien Kommunikation, das Bürger*innen dazu einlädt, miteinander ins Gespräch über wichtige, sie betreffende Fragen zu kommen. Inspiriert durch die Arbeit von Alex Samy (Museum am Bach, Ruden/Kärnten) greift es die Idee von Joseph Beuys („Jeder ist ein Künstler“) auf, der zufolge jede*r Mitgestalter*in der eigenen Stadt ist. Das Format wurde vom Institut für integrale Studien im Rahmen des EU-Projekts „Leadership for Transition Politics“ aufgegriffen und weiterentwickelt und 2022 erstmals nach Freiburg und in die Regio gebracht. So finden seit 2024 etwa in Hinterzarten regelmäßig Runde Tische statt, aus denen bereits mehrere konkrete Projekte für ein besseres Miteinander im Dorf hervorgegangen sind.
„Die Zukunft, die wir wollen, muss gefunden werden. Sonst erhalten wir die Zukunft, die wir nicht wollen!“ (Joseph Beuys)
Wir stellen uns vor, dass die Stadt Freiburg einen oder mehrere Runde Tische anschafft, die dann, unterstützt durch eine kompetente Moderation, z.B. einmal monatlich an wechselnden Orten (in verschiedenen Stadtteilen) stattfinden, und an denen alle Interessierten teilnehmen können. Mit Hilfe dieser Runden Tische gelingt es, den Zusammenhalt in der Stadt zu stärken und die Demokratie vor Ort lebendiger zu machen. Denn wenn Menschen mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen, Werten und Ideen auf eine Weise zusammenkommen, die über gewohnte Denk- und Gesprächsmuster hinausgeht, können sie als wesentlich empfundene Fragen tiefer erkunden.
Und wo die gemeinsame Vorstellungskraft und kollektive Intelligenz engagierter Bürger*innen einen Raum bekommt, beginnen sie, gemeinsam neuartige Lösungen zu erschließen, die durch Einzelne allein nie erdacht werden könnten. So können Runde Tische nicht nur zu einem besseren Einvernehmen mit anderen Mitbürger*innen, in der Gesellschaft insgesamt und mit unserer natürlichen Umwelt beitragen. Indem sie dazu einladen, gemeinsam neue Wege zu gehen und bestehende Denk-Grenzen zu überwinden, ermöglichen sie uns, die Macht der Zusammenarbeit und des Dialogs im öffentlichen Raum zu nutzen, um gemeinsam eine nachhaltige und gerechte Zukunft zu gestalten.

Mehr Informationen zum Runden Tisch:
- Handbuch: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://leadership-for-transition.eu/wp-content/uploads/2022/11/IO2-Der-Runde-Tisch_DE.pdf
- RT in Hinterzarten: https://www.ifis-freiburg.de/2024-04/ueberraschend-kreativ-runder-tisch-hinterzarten und https://www.ifis-freiburg.de/2025-03/kohaerenz-aktion-wie-die-magie-des-runden-tisches-flow-erzeugt
Demokratie 2050
„Stellen wir uns vor, die Demokratie wäre in 20 Jahren noch viel stärker, lebendiger und überzeugender als heute“.
Ich stelle mir vor, dass die öffentliche Daseinsvorsorge, d.h. die Bereiche Wasser, Energie, Mobilität, Bildung, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Kommunikation und soziale Sicherung rein staatlich verant-wortete Bereiche sind, die per Gesetz von der Bürgerschaft auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, kontrolliert, begleitet und mitverantwortlich weiterentwickelt werden.
Ich stelle mir vor, dass Schule für alle Lehrenden und Lernenden ein Ort der praktischen und theoret-ischen Aneignung von Demokratie und demokratischer Kompetenz ist. Die schulische Organisation und -verwaltung vor Ort hat dabei einen offenen Gestaltungsspielraum, der von allen Beteiligten genutzt und verantwortet wird.
Ich stelle mir vor, dass gesetzlich vorgegebene demokratische Beteiligungsstrukturen keine hemmen-den formalen Hindernisse mehr sind, sondern als effiziente, lebendige und kreative Chancen aktiv wahrgenommen und gelebt werden.
Ich stelle mir vor, dass die öffentlich-rechtlichen Medien eine zentrale und wichtige Rolle in der öffentlichen Diskussion haben, als Plattform für gesellschaftliche Diskurse und dabei wegen ihren sachlichen Informationen in der Gesellschaft anerkannt sind.
Ich stelle mir vor, dass eine staatliche Ausgaben- und Einnahmenpolitik die
Verantwortlichkeit und die Sozialpflichtigkeit von Eigentum und Vermögen mit Blick auf eine bessere Leistungs- und Verteilungs-gerechtigkeit immer wieder neu bewertet und umsetzt.
Ich stelle mir vor, dass Menschen, die öffentliche Ämter und Funktionen wahrnehmen, bzgl. ihrer Interessen, ihres Hintergrunds, ihrer politischen Orientierung und ihren anderweitigen Funktionen und Ämter, transparent und nachweisliche Angaben machen.
Ich stelle mir vor, dass unser repräsentatives System durch neue Beteiligungsformate eine höhere Rückbindung und Effizienz der gewählten Volksvertretenden auf allen Ebenen hat.
Ich stelle mir vor, dass die politisch Verantwortlichen Lust auf Beteiligung bewirken, in dem sie Probleme und Sachverhalte verständlich darstellen, mögliche Lösungswege vorzeichnen und die betroffenen Menschen in Entscheidungen, d.h. in die Mitverantwortung nehmen.
von Albrecht Schwerer
Gedanken zur Zukunft unserer Demokratie
Absicht dieses Textes ist es, den Blick für eine vielleicht etwas ungewöhnliche Perspektive zu sensibilisieren, die uns in den alltäglichen politischen Diskussionen entgehen mag
Es kommt einem ja manchmal so vor, als wenn es die Vorstellung gäbe, dass unsere Demokratie gerettet wäre, wenn « die Rechten » besiegt oder verboten worden sind. Was wäre, wenn die größte Gefahr für unsere Demokratie gar nicht von den « Rechten » kommen würde ? Was wäre, wenn sich die « Linken » in den letzten Jahren zu stark vom Machterhalts- und Systemsicherungsstreben und vom Lobbyismus der ganz großen Politik haben kapern lassen ? Was wäre - wenn das so weitergeht - Alle : die Linken, die Rechten und die freie Zivilgesellschaft unter dem gleichen Bus landen. Einem Bus, der in einem sehr schmalen Korridor unterwegs ist. Einem Korridor der geprägt ist von einem digitalen Überwachungskapitalismus, einer extremen politischen Korrektheit und von KI-gestützten Kontroll- und Nudgingsystemen, die vorgeben, genau zu wissen was richtig und falsch, was gut und böse, was Information und Desinformation, was Fake und Fakten, was demokratisch und undemokratisch ist !
Wir leben im Zeitalter von Überwachungssystemen wie Palantir, einer EU-weiten Chatkontrolle, die in den privaten Kommunikationsraum eindringen möchte. Wir leben im Zeitalter eines Digital Service Act, der nicht nur illegales, sondern auch politisch unkorrektes Verhalten sanktionierbar macht und von geplanten digitalen Zentralbankwährungen, die wirklich jede Transaktion speicherbar, überprüfbar und kontrollierbar machen könnten. Wir leben im Zeitalter von internationalen Gesundheitsvorschriften und Pandemieverträgen, die nicht gewählten Autoritäten eine atemberaubende Macht über nationale Gesetze geben. Wir leben im Zeitalter von Faktencheckern, die den « Faktengecheckten » so gut wie keinen Raum zur Gegendarstellung einräumen und von Trusted Flaggers, die autorisiert sind, Internetinhalte löschen zu lassen, ohne, dass man das überhaupt mitbekommt. Wir leben in Zeiten, in denen es die Zivilgesellschaft nicht nur mit nationaler Regierungsmacht zu tun hat, sondern auch mit einer Europäischen und sogar mit einer Globalen, die sich in Konstrukten, wie « Global Private Public Partnerships » äußert. Letztere sind Zusammenschlüsse aus Regierungen, großen Stiftungen, Banken, Medienkonzernen und Großkonzernen, die völlig neue Dynamiken und Herausforderungen für demokratische Prozesse kreiren. War Demokratie nicht einmal die Idee der « Einhegung von Macht » und von einer aufgeklärten und verantwortungsbewussten Bürgerschaft, die sich jederzeit abwählbare würdige Vertreter sucht, um Staatsgeschäfte zu gestalten ?
Die kollektive Intelligenz einer gesunden Zivilgesellschaft kann sich doch nur entwickeln, wenn man sich umfassend und transparent informieren kann. - Wenn es keinerlei Zensur gibt, und wenn der einzelne Mensch das Gefühl haben kann, frei seine Meinung äußern zu können, auch, wenn sie eine abweichende oder vielleicht sogar eine abstruse Meinung ist – und das ohne diffamiert oder sanktioniert zu werden. Es sollte Raum und Respekt geben für die individuelle Selbstverantwortung, die, genau, wie die freie klassische Wissenschaft seit spätestens 2020 unter großen Druck geraten ist. Weitere Bausteine sind eine entschlossene Kultivierung von Diplomatie in internationalen Beziehungen, echter Dialogbereitschaft in politischen Diskussionen und einem integrativen Denken der Führungskräfte. So hätten wir gute Chancen, die kollektive Intelligenz unserer Zivilgesellschaft zum Wohle von Natur, Mensch und organischen Lebensbedürfnissen zu nutzen und damit auch angemessen und sachlich auf Herausforderungen wie die Zunahme schwerer Krankheiten, Pandemien, Krieg und Klimaveränderungen zu reagieren.
Wenn am Ende die freie Zivilgesellschaft, nicht der große Verlierer sein soll, könnten wir kleinen und großen Spaltungsprozessen entschlossen und mit Neugier, Mut, Lern- und Dialogbereitschaft entgegenstehen. Wir könnten und sollten voneinander lernen. Auch und vielleicht gerade von den Abweichlern, den Menschen und Gruppen mit abweichendem Verhalten, von den Rändern und sei es von den « Symptomträgern ». Nicht die « Rechten » pauschal verteufeln, sondern sorgfältig schauen, welche guten Kernthemen und Argumente sie haben und sich vom Rest klar abgrenzen. Und genauso bei den « Linken » und allen anderen Parteien. Schnittmengen und Überschneidungen und Konsens suchen und diese « bewässern » !
*
Solch ein kurzer Text in Bezug auf eine so große Thematik kann natürlich nur vage bleiben, wird viele Fragen aufwerfen und mag zu viele Schlagworte enthalten. Wer sich mehr für die Inhalte interessiert, die dahinter stehen, könnte sich folgende Quellen anschauen.
* « Umgekehrter Totalitarismus – Faktische Machtverhältnisse und ihre zerstörerischen Auswirkungen auf unsere Demokratie » -Sheldon S. Wolin (amerikanischer Politikwissenschaftler)
* « Die Psychologie des Totalitarismus » - Matias Desmet (belgischer Psychologie-Professor)
* « Kognitive Kriegsführung – Neueste Manipulationstechniken als Waffengattung der NATO » & « Kriegsspiele – Wie NATO und Pentagon die Zerstörung Europa´s simulieren » - Dr. Jonas Tögel (deutscher Amerikanist und Propaganda-Forscher)
* « The Tragedy of Great Power Politics » - John Mearsheimer (amerikanischer Politikwissenschaftler)
* « Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus » - Shoshana Zuboff (amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin)
* « Das indoktrinierte Gehirn » - Dr. Michael Nehls (deutscher Arzt, Molekular-genetiker und Bestsellerautor)
* « Vereinnahmte Wissenschaft – die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts » - Bastian Barucker (deutscher Wildnispädagoge, Journalist und Autor) & « Und die Freiheit ? – Wie Corona-Politik und der Missbrauch der Wissenschaft die offene Gesellschaft bedrohen » – Christoph Lütge und Michael Esfeld (Professoren für Wirtschaftsethik und Wissenschaftsphilosophie) &„Gekaufte Forschung – Wissenschaft im Dienst der Konzerne“ – Christian Kreiß (Professor für Volkswirtschaftslehre und ehemaliger Investmentbanker)
* « Tabu – Was wir nicht denken dürfen und warum » -Raphael M. Bonelli (österreichischer Psychiater und Neurowissenschaftler)
* Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) : Extremismusforscher Eckhard Jesse: « Die Angst vor der AfD ist irrational » - Der Politikwissenschaftler und Mitherausgeber des Jahrbuchs „Extremismus und Demokratie“ Eckhard Jesse teilt die Sorge nicht, dass die deutsche Demokratie durch den Rechtsruck in Gefahr sei. Er rät zu mehr Gelassenheit und Toleranz https://www.nzz.ch/international/der-extremismusforscher-eckhard-jesse-die-angst-vor-der-afd-ist-irrational-ld.1911081?ga=1&kid=nl164&mktcid=nled&mktcval=164&utm_medium=EMAIL&utm_source=MoEngage
von Mattheo Pfleger
Der basisrepublikanische Rat
Ziel:
Einbindung der einzelnen Menschen in die demokratischen Prozesse
Selbstwirksamkeit der Menschen stärken
Gräben überbrücken, gegenseitiges Verständnis pflegen
Tragfähige Lösungen finden für die großen Themen unserer Zeit: Klima, Rente, Zuwanderung, Rüstung, Innenstadtsterben; ebenso für die kleinen wie Verkehrsberuhigung, Aufenthalte in Parks etc.
Für diese Lösungen großen Zuspruch erreichen
Falschinformationen und Populismus wirksam begegnen
Modell:
Vorgehen
In Bezug auf ein konkretes Thema werden alle von der Fragestellung betroffenen Menschen und Gruppen eingeladen, um ihr Interesse und ihre Interessen einzubringen
Es werden die entsprechen Fakten, Voraussetzungen, Grundbedingungen geklärt.
Aus den Interessen werden die unterschiedlichen Bedürfnisse (im Sinne Rosenbergs) herauskristallisiert. Dabei wird auch an diejenigen derer gedacht, die erst in Zukunft geboren werden oder die zwar betroffen sind, aber nicht so einfach dazukommen können (wie die Person, die durch den Klimawandel das eigene Land verlieren wird oder mit massiven Missernten zu rechnen hat usw.). So entsteht ein bunter Strauß von Bedürfnissen.
Für jedes Bedürfnis findet sich mindestens eine Vertreterin. Diese Gruppe bildet den Basisrepublikanischen Rat.
Die Bedürfnisse werden artikuliert, wobei von den anderen aktiv zugehört wird.
Es wird nach Lösungen gesucht, die allen Bedürfnissen gerecht werden.
Die verschiedenen Lösungen werden betrachtet nach Chancen und Aufgaben, nicht nach Vorteilen und Nachteilen.
Die Aufgaben werden nach ihrer Realisierbarkeit geprüft. Ggf. wird damit gleich die Verantwortlichkeit für die jeweilige Frage/Aufgabe geklärt.
Realisierbare Lösungsmodelle bleiben erhalten, wobei sie nun auch nochmals modifiziert werden können, z. B. indem man zwei oder drei zusammenfasst.
Ein erstes Stimmungsbild gibt Aufschluss über die Tendenz, die in der Gruppe herrscht. Nun werden die Teilnehmenden gefragt, was passieren müsste, damit sie sich zu einer anderen Lösung entscheiden könnten, wie also der eine oder der andere Lösungsansatz zu ergänzen wäre, um volle Zustimmung zu erhalten. Diese Ergänzungen werden zugefügt, sofern möglich.
Entschluss, sobald mit obigen methodischen Schritten ein Konsens gefunden wurde.
Transparenz:
Alle Sitzungen werden live gestreamt.
Alle Dokumente sind öffentlich zugänglich.
Anbindung:
Es ist jederzeit möglich, von außen Ideen und Impulse dazuzugeben.
Fachlichkeit:
Es ist jederzeit möglich, fachkundige Menschen beratend hinzuzuziehen.
Umsetzung
Idealerweise hätten wir dieses System vom Grundgesetz gesichert anstelle unserer bisherigen repräsentativen mehrheitsdemokratischen Verfahren.
Konkret und zeitnah umzusetzen wäre ein Prozess in dieser Art parallel zu parlamentarischen Abläufen.
Den Unterschied eines solchen Verfahrens zu den bisher bekannten Bürger*innenräten findet man in verschiedenen Punkten:
A) Dadurch, dass der Rat von den Betroffenen gebildet wird, ist eine persönliche Anbindung an diejenigen gegeben, die nicht im Rat selbst sitzen. Diese Verbundenheit wird weiter vertieft durch die Transparenz der Sitzungen.
B) Dadurch, dass Ideen aus den verschiedenen Bedürfnissen aller Betroffenen gebildet werden, und nicht von zufällig gewählten Bürger*innen, ist eine inhaltliche Anbindung gegeben.
C) Dadurch, dass Bedürfnisse die Basis einer Ideenfindung bilden und nicht Wünsche, Interessen, Meinungen und Positionen, hören wir einander offener und respektvoller zu (vgl. Rosenberg: GfK).
D) Ein Konsens, der mit allen Betroffenen gefunden wird, entfaltet große Macht gegenüber den parlamentarischen Vertreter*innen. Wenn eine Lösung also von einer Managerin eines bedeutenden Arbeitgebers genauso wie von einem Bürgergeldempfänger Unterstützung findet, wenn sie genauso getragen wird von klassischen Linken wie Rechten, wird es einer Partei nur zu schaden kommen, sich dagegen auszusprechen. Diese Wirkung erreichen wir durch die persönliche und die inhaltliche Anbindung (A und B).
E) Diesen Konsens erreichen wir nicht durch Bewerten von Lösungsansätzen, sondern durch den Blick auf die Chancen aller Modelle und die anschließende Nennung der damit verbundenen Aufgaben. Mit Ersterem geben alle Teilnehmenden jedem Modell eine Chance, was ihnen hilft, den Blick zu weiten und eigene Vorstellungen, Meinungen und Positionen zu überwinden. Durch Letzteres werden Bedenken und Sorgen, die wir ja nicht bearbeiten können, zu Fragen, denen Handlungen folgen können: Wir werden handlungsfähig! – BTW: Wir lösen uns mit diesem Vorgehen von einem polaren Denken und finden zu einer Haltung, die nicht polarisiert, sondern verbindet. Diese Wirkung wird durch eine Abstimmung mit „dafür – dagegen“ nicht erreicht.
F) Dadurch, dass keine Kompromisse, sondern ein Konsens gesucht wird, werden die Lösungen den Themen (Klima, Rente usw.) in vollem Umfang gerecht.
G) Zusammenfassend ist festzuhalten:
Durch eine persönliche wie inhaltliche Anbindung werden Transparenz, Selbstwirksamkeit und Mitverantwortung in der Bevölkerung gestärkt. Im Wahrnehmen von den verschiedenen Bedürfnissen entsteht Verbundenheit unter den Menschen. In Verbindung mit dem Ziel, einen Konsens zu finden, entsteht eine machtvolle Entscheidung, die großes Potenzial für Nachhaltigkeit mitbringt.
von Roland Schulze-Schilddorf, im Dezember 2025